DW - Handwerkssprache | Текст песни
Das Eisen schmieden solange es heißt ist
Handwerker spielten seit dem Mittelalter eine wichtige Rolle in Deutschland. Ihr großer Einfluss im öffentlichen Leben spiegelt sich auch in Redewendungen wider, die bis heute in der Umgangssprache zu finden sind.
Sprecher:
Die Handwerker waren in den so genannten Zünften zusammengeschlossen. Hier wachten die Handwerksmeister über Können und Ehrbarkeit ihrer Mitglieder und legten in der so genannten Zunftordnung ihre Pflichten und Rechte fest. Verletzungen dieser Ordnung – sei es durch Übergriffe eines Handwerkers in das Gebiet eines anderen, sei es durch Leute, die außerhalb der Zunft standen – wurden heftig bekämpft.
Sprecherin:
Na ja, es lässt sich auch niemand gern ins Handwerk pfuschen, auch dann nicht, wenn man gar kein Handwerker ist. Mal sehen, was die Leute auf der Straße dazu meinen.
O-Ton:
"Wenn ich am Herd stehe und koche, und genau weiß, wie ich mein Gericht zubereiten möchte, und jemand anders daneben steht und mir ständig Verbesserungsvorschläge macht, oder mir ständig erzählt, wie ich was zuzubereiten habe. Das ist für mich ins Handwerk pfuschen und das passt mir dann nicht und dann kann ich auch sehr ungnädig werden."
Sprecherin:
Da haben wir es. Der Herr ist gar kein Handwerker, sondern er fühlt sich beim Kochen gestört, weil sich jemand ungefragt einmischt. Aber was bedeutet eigentlich pfuschen?
Sprecher:
Der Pfuscher war derjenige, der die Zunftordnung verletzte, etwa ein Geselle, der sich nach Feierabend etwas dazuverdienen wollte oder ein Schmied, der Schlosserarbeiten durchführte – was nicht zu seinem Aufgabenbereich gehörte. Solche Arbeiten wurden oft – da unerlaubt – mehr schlecht als recht zusammengeschustert, das heißt hastig und ohne die nötige Sorgfalt ausgeführt. Das Ergebnis entsprach dann nicht den Anforderungen der Zunft. Die Arbeit war verpfuscht.
Sprecherin:
Das heißt also, der Herr, der sich beim Kochen gestört fühlt, ärgert sich nicht nur darüber, dass sich jemand in seine Angelegenheit einmischt. Er unterstellt dem Störenfried auch, dass dieser von dieser Angelegenheit nicht so viel versteht wie er selbst; dass er das Essen nur verderben würde mit seinen Einmischungen.
Sprecher:
Ja die Meister sahen sich als die wahren Könner ihres Handwerks. Auch zwischen Meistern, Gesellen und Lehrlingen wurden große Unterschiede gemacht. Zahlreiche Redewendungen zeugen von der überlegenen Position, die die Meister innehatten – und weisen den Lehrling in seine Schranken. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen belehrt ein altes Sprichwort. Der Berufsanfänger musste damals wie heute erst einmal drei Jahre bei einem Meister in die Lehre gehen. Dass das nicht immer lustig war, davon zeugt noch die Wendung Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Erst nach bestandener Gesellenprüfung wurde der junge Handwerker in den Gesellenstand aufgenommen. Die Aufnahme wurde als Zeremonie begangen, bei der je nach Handwerk mitunter recht schmerzhafte Rituale vollzogen wurden. Die Tischler zum Beispiel unterzogen die Gesellenanwärter einer symbolischen Bearbeitung. Sie wurden gehobelt, also wie ein raues Stück Holz glatt gerieben und geschliffen. Ein ungehobelter und ungeschliffener Geselle war einer, der diese Zeremonie noch nicht hinter sich gebracht hatte. Dieser Sprachgebrauch ist bis heute erhalten geblieben.
Sprecherin:
Das wollen wir doch mal sehen. Wer ist denn ein ungehobelter Mensch?
O-Töne:
"Ungehobelter Mensch? Das ein Mensch, der schlechte Manieren hat. / Ungehobelter Mensch – der sich so ausdrückt wie es ein anderer nicht hören möchte, aber dabei vielleicht trotzdem die Wahrheit sagt."
Sprecher:
Die Gesellen hatten ihre eigenen Zusammenschlüsse. Sie waren in den so genannten Schächten organisiert. Die Sch
DW еще тексты
Сейчас смотрят
- DW - Handwerkssprache
- J&J - Darty - Мы не остыли
- Husky Rescue - New Light Of Tomorrow [Bonobo Remix] [club47976767]
- Sander Van Doorn - Identity 335 23-04-2016 vk.com/RadioIntense
- Музика - Розминка
- сайт знакомств табор ру моя страница - darling сайт знакомств
- линклин парк - лиав ов ол рест
- Алиночка - Menu...
- Strawberry Switchblade - By The Sea (Korova '84) - Cинглы / Single_s
- Записки о Шерлоке Холмсе - 1-7_исп.Станислав Федосов
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 2
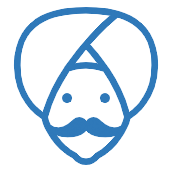 Гуру Песен
Гуру Песен